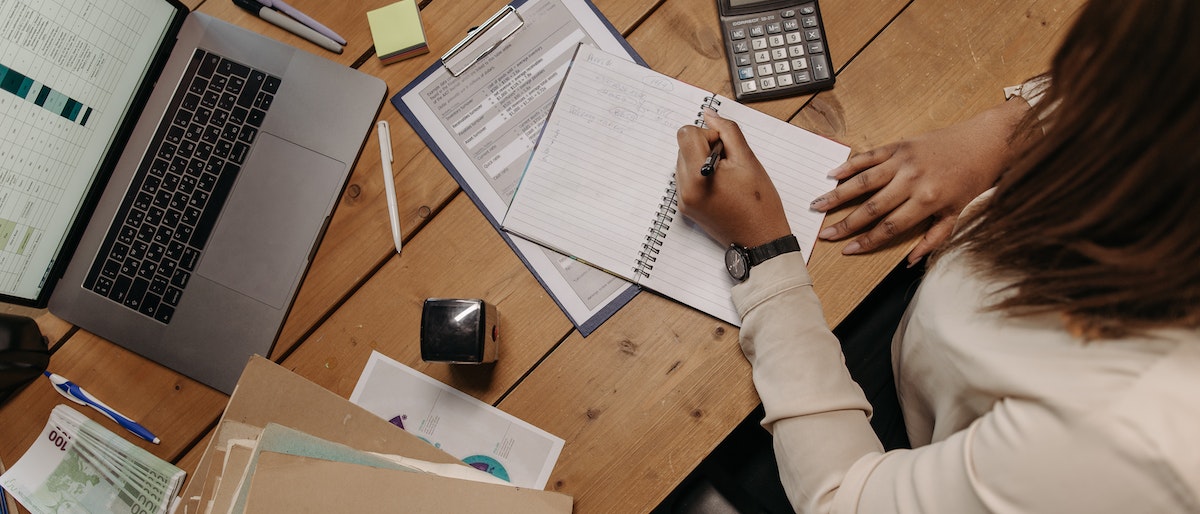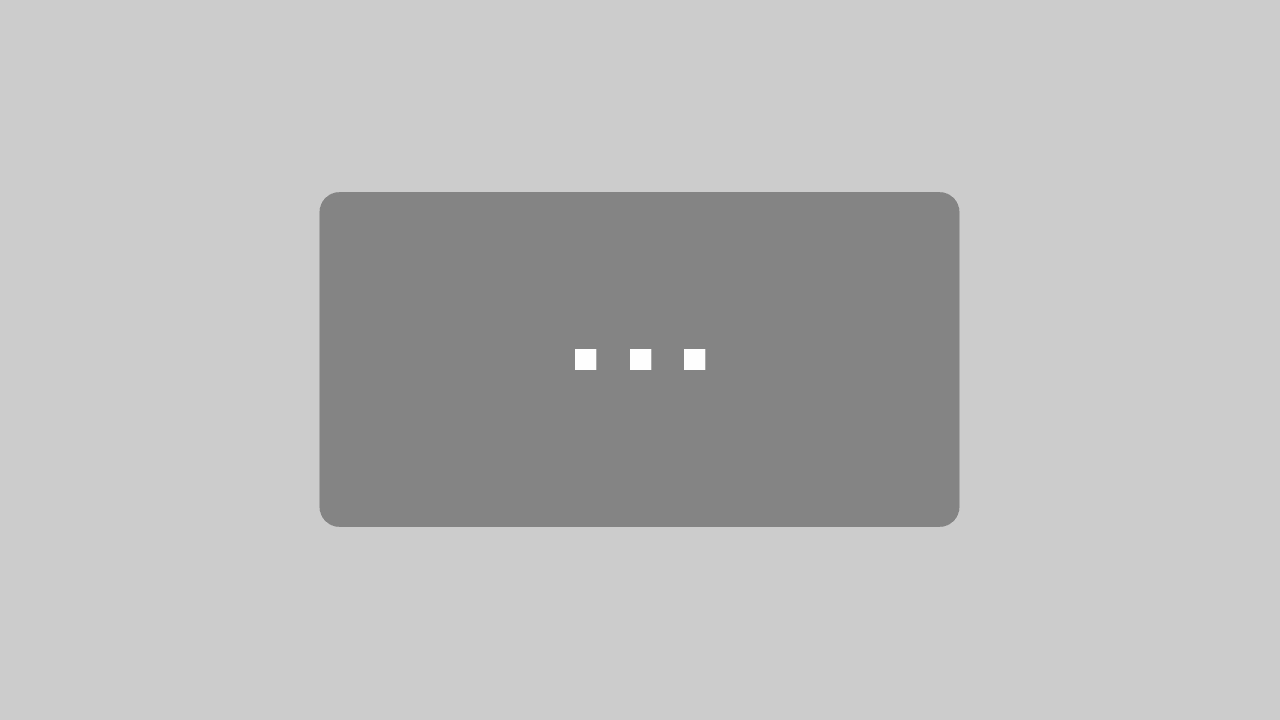Im Verhältnis Deutschland-Schweiz werden leitende Angestellte abweichend von den übrigen Regeln nicht dort besteuert, wo die Arbeit ausgeübt wird, sondern dort, wo die Gesellschaft ihren eingetragenen, statuarischen Sitz hat. So kann der in Deutschland lebende Geschäftsführer einer Schweizer Gesellschaft mit seinen Einkünften selbst dann in der Schweiz besteuert werden, wenn er die Arbeit überwiegend von Deutschland aus erledigt. Die Vorschriften sind auch schwer zu verstehen, weil es neben dem eigentlichen Abkommen die Ministerien beider Länder eine Reihe von Konsultationsvereinbarungen (KonsVerCHEV) und Ergänzungen vereinbart haben. Darüber kam gab es oft zum Streit mit dem Finanzamt.
Der Bundesfinanzhof hat einer einer Fülle von Urteilen zum deutsch-schweizer Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) neuerdings klargestellt, dass der Vorrang des Gesetzes und damit der Wortlaut des DBA gilt. Die Vorschrift des § 19 Abs. 2 Satz 2 KonsVerCHEV, so der BFH, habe lediglich den Rang einer Rechtsverordnung und verstößt damit gegen den Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes (hier: Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz) und ist unwirksam. Das hat weit reichende Folgen auch für bereits abgeschlossene Jahre, weil die Rechtsprechung immer auch für alle offenen oder noch änderbaren Jahre anwendbar ist.
Voraussetzung für die Behandlung als Leitender Angestellter war in der Vergangenheit sowohl aus deutscher als auch aus schweizer Sicht, dass die Vorstandsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Prokuristen, wie eingangs erwähnt, mit dieser Funktion im Handelsregister eingetragen sind. Das steht so zwar nicht im Doppelbesteuerungsabkommen, aber in einer Konsultationsvereinbarung. Diese ist aus deutscher Sicht nach der Rechtsprechung des BFH nunmehr hinfällig.
Die Schweizer Behörden orientieren sich nicht an der Rechtsprechung deutscher Gerichte und fühlen sich weiterhin an die Konsultationsvereinbarung gebunden. Damit kann und wird es zu Qualifizierungskonflikten kommen. Der sicherste Weg ist deshalb immer noch, die Funktion im Handelsregister eintragen zu lassen. Wer nicht eingertagen ist, sollte dennoch genau prüfen, ob er / sie von der neuen Rechtspechung profitiert.
Der vom BFH entschiedene Fall lag so, dass der in Deutschland ansässige Angestellte als CFO, Chief Financial Officer Group“ bei einer Schweizer AG angestellt und der höchsten Managementstufe des Konzerns zugeordnet war. Er wurde mit „Kollektivunterschrift zu zweien“ ohne Funktionsbezeichnung im Handelsregister eingetragen. Er kehrte an mehr als 60 Arbeitstagen nicht an seinen Wohnsitz in Deutschland zurück, sodass er kein Grenzgänger i. S. d. Artikel 15 a DBA Schweiz war. Diese Feststellung ist wichtig, weil auch ein leitender Angestellter Grenzgänger sein kann und dann in seinem Ansässigkeits-Staat besteuert wird. Seine Tätigkeit übte der Kläger an 63 von 240 Arbeitstagen in Drittstaaten und in Deutschland aus. Das Finanzamt wollte ihn wegen der nicht eingetragenen Funktion mindestens mit diesen 63 Tagen in Deutschland besteuern.
Doch der BFH lehnte dies ab. Er begründete dies damit, dass nach dem Wortlaut des DBA die Einkünfte einer in Deutschland ansässigen Person aus einer Tätigkeit als Vorstandsmitglied, Direktor, Geschäftsführer oder Prokurist einer in der Schweiz ansässigen Kapitalgesellschaft in der Schweiz besteuert werden, sofern die Tätigkeit nicht so abgegrenzt ist, dass sie lediglich Aufgaben außerhalb der Schweiz umfasst. Von einer Eintragung im Handelsregister ist im DBA nicht die Rede. Die Konsultationsvereinbarung beachtete der BFH nicht, weil eine Vereinbarung selbst auf höchster verwaltungsebene keinen Gesetzesrang haben kann. Den BFH interpretieren wir so, dass nicht nur ein CFO, sondern z.B. auch ein nicht im Handelsregister eingetragener Personalvorstand im den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen kann, wobei die Umstände des Einzelfalls zu beachten sind.
Ist ein leitender Angestellter jedoch als Grenzgänger zu qualifizieren, dann wird er mit seinem Einkommen am Wohnsitz besteuert. Ist der leitende Angestellte aber bei mehr als 60 Nichtrückkehrtagen nicht als Grenzgänger einzustufen, so besteuert er seinen Lohn in der Schweiz. Er unterliegt dann einem besonderen Besteuerungsverfahren. Die auf das Gehalt entfallende Quellensteuer, die sich auch nach dem Familienstand und der Anzahl der Kinder richtet, wird vom Arbeitgeber einbehalten und an das Steueramt der Gemeinde, in der der Arbeitgeber seinen Sitz oder seine Betriebsstätte hat, abgeführt. Diese Steuer wird dann auf die Einkommensteuer des Angestellten angerechnet.